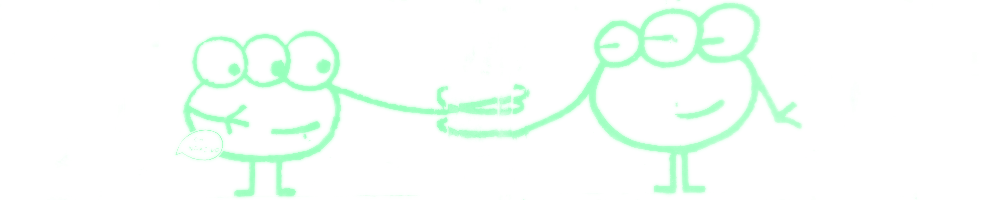Und wieder mal Linkhaftung
Aus dem Impressum des Landgerichts Karlsruhe:
Diese Internetseite enthält auch Links oder Verweise auf Internetauftritte Dritter. Diese Links zu den Internetauftritten Dritter stellen keine Zustimmung zu deren Inhalten durch den Herausgeber dar. Es wird keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Internetauftritte übernommen und keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der Nutzung — gleich welcher Art — solcher Inhalte entstehen. Mit den Links zu anderen Internetauftritten wird den Nutzern lediglich der Zugang zur Nutzung der Inhalte vermittelt. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und für Schäden, die aus der Nutzung entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.
Und genau dieses Gericht faßt dann auch solche Beschlüsse, in dem es nicht nur auf die Haftung für das Setzen von Links bestätigt, sondern auch dem Leser die Internetwelt wieder erklärt wird. Beispielsweise in der Unterscheidung zwischen eines »einfachen Links« und einer »Sprungmarke« (wobei es sich nach meinem Verständnis um eine nicht direkt sichtbare Weiterleitung gehandelt hat. Korrgiert mich, wenn ich falsch liege). Oder »die moderne Datenübertragung im Internet« — erinnert sich noch jemand an die Zeiten, als die Bits und Bytes im Morsecode per Rauchzeichen übertragen worden sind?
Trotzdem sollte man auch anmerken, daß es auch andere Beweggründe gab, insbesondere Vorstrafen. Aber die lesen sich in diesem Beschluß nur als unterstützende Nebenfaktoren heraus. Somit bleibt das ganze nur ein fragwürdiger Beschluß, der vor dem Bundesverfassungsgericht nun hoffentlich noch einmal näher erörtert wird.
Hintergrund des Urteils war eine Hausdurchsuchung beim Betreiber der Domain wikileaks.de. Diese Plattform verweist auf ein gemeinnütziges Projekt mit der Top-Level-Domain org. Und auf dieser sind vor kurzem unter anderem die dänische Zensurlisten gegen KiPo erschienen. (vgl. heise, Umgebungsgedanken)