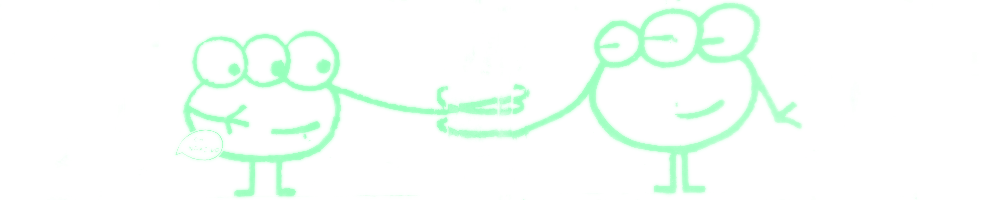Das Kleingedruckte beim Lastschriftverfahren
Mir ist das Lastschriftverfahren schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge. Wer damit bezahlt, bekommt einen Wisch in die Hand. Durch den sozialen Druck der Warteschlange ist man gewissermaßen gezwungen, möglichst schnell zu unterzeichnen. Und oft verbleibt dann dieser Zettel in der Kaufhalle.
Doch was steht in dem Kleingedruckten wirklich drauf?
1. Ermächtigung zum Lastschrifteinzug
Hiermit ermächtige ich o.g. Vertragspartner (Händler) und easycash GmbH, Am Gierath 20, 40885 Ratingen (easycash), umseitig ausgewiesenen Rechnungsbetrag von meinem durch Kontonummer und Bankleitzahl bezeichneten Konto durch Lastschrift einzuziehen und verpflichte mich, auf dem Konto für die notwendige Deckung zu sorgen.
Dieser Punkt ist soweit unstrittig.
2. Ermächtigung zur Adressweitergabe
Ich ermächtige das kartenausgebende Kreditinstitut unwiderruflich, dem Händler und easycash auf Anforderung meinen Namen und Anschrift zur Geltendmachung der Forderung mitzuteilen.
Ich war bisher davon ausgegangen, daß dieser Anspruch nur im Falle einer Rücklastschrift eintritt. Doch Fehlanzeige. Diese Unternehmen machen ja mit jedem Zahlungsvorgang eine Forderung ja geltend: sie wollen das Geld vo Konto einziehen,
3. Datenverarbeitung
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung speichert easycash die auf dem Magnetstreifen der Karte gespeicherten Daten (Konto-Nr., Bankleitzahl, Kartenfolge-Nr., Kartenverfallsdatum) sowie Datum, Uhrzeit, Ort und Betrag. Wird eine Lastschrift aus unbestrittener Forderung vom kartenausgebenden Kreditinstitut zurückgegeben (Rücklastschrift), so wird diese Tatsache in die Sperrdatei der easycash aufgenommen. Bis zur Bezahlung der offenen Forderung ist eine Teilnahme am Lastschriftverfahren bei den an die Sperrdatei angeschlossenen Unternehmen nicht möglich. easycash nutzt die für die Zahlungsabwicklung gespeicherten Daten außer bei berechtigtem Widerspruch auch zur Festlegung künftiger Zahlungsverfahren und übermittelt angeschlossenen Unternehmen auf deren Basis Zahlungswegeempfehlungen.
Der erste Teil entspricht dem Zweck der Lastschrift. Eine Sperrdatei zum Selbstschutz kann ich gewissermaßen noch akzeptieren. Doch es wird nicht erklärt, was die »bei den an die Sperrdatei angeschlossenen Unternehmen« sind. Nur Händler? Andere Finanzdienstleister? Schufa?
4. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle ist neben dem Händler easycash, die auch die oben genannte Sperrdatei führt.
Klar, Grundsatz Nummer 1: Nur Bares ist Wahres gilt fortan.
Ansonsten ist das PIN-Verfahren in der Hinsicht sinnvoller, da das Geld direkt auf Reise geht und es folglich keine Ansprüche gibt, für die Daten erhoben werden können.
In der Konsequenz könnte man beim Bezahlen auf PIN bestehen. Die Frage ist dann, in wie weit die Läden in die Kassenprozesse eingreifen können. Natürlich macht das erst einmal mehr Aufwand. Die Frage wäre dann, was passiert, wenn man droht, den Einkauf platzen zu lassen (Lange Schlange, die können die ganzen Kaufartikel wieder ins Regal räumen etc.). Findet der Händerler sicherlich nicht so toll. Von daher sollte man die bargeldfreien Zahlungen erst einmal außerhalb probieren. Spannend dürfte das Spiel bei Tankstellen sein, wo man die »Ware« nicht zurückgeben kann.
Insgesamt ist das ganze natürlich ein Kampf gegen Windmühlen. Es bewegt sich vermutlich nur dann was, wenn jeder dritter so denkt und der Einzelhandel darüber verflucht. Das wird wohl leider nicht eintreten!