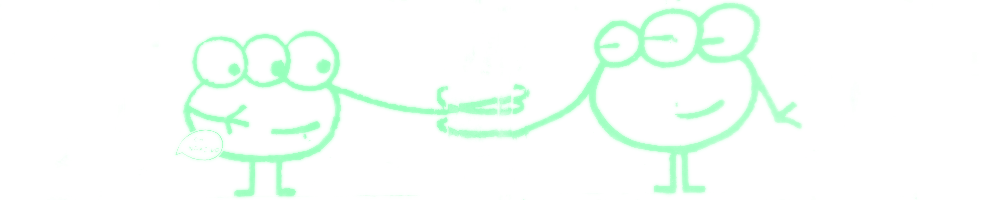Vorbemerkung: Der Artikel entstand im Rahmen des Bürgerschaftswahlkampf 2020.
Pünktlich in der heißen Phase des Wahlkampfes beschließt der Hamburger Senat die sogenannte Digitalstrategie dieser Stadt. In dem Dokument stellt sich einerseits Hamburg selbst ein gutes Zeugnis aus, andererseits werden Wahlkampfziele der SPD schon verarbeitet, wie bspw. die Tschentscher’sche Gedenkbibliothek in Form des „Hauses der digitalen Welt“. Mit diesem Beitrag möchte ich dieser Strategie auf den Zahn fühlen.
Fangen wir zunächst mit der B-Note an: die Strategie selbst ist eine PDF-Datei mit 60 Seiten und wirkt wie mit der heißen Nadel gestrickt. Es gibt keine internen Lesezeichen und Verlinkungen. Teilweise ist der Text auf Bildern sehr schwer lesbar. Im Kapitel „Barrierefreiheit“ wird von Leichter Sprache gesprochen, doch dieses Dokument ist das komplette Gegenteil davon. Möglicherweise ist es aber auch das Ziel, dass möglichst wenige Menschen diese Dokument lesen und verstehen. Ich habe es trotzdem gemacht.
Digitalisierung selbst ist ein politisches Modewort geworden. Man kann darunter Alles oder Nichts verstehen. Allein die Tatsache, dass in den Behörden keine mechanischen Schreibmaschinen mehr genutzt werden, betiteln einige bereits als Digitalisierung. In dieser Digitalstrategie steht unter anderem die Maßnahme „Online Terminvergabe“ für’s Hamburger Impfzentrum. Im Jahr 2020 ist schon mancher Hausarzt weiter. Andere Projekte wie das „Monitoring der Bodenversiegelung“ bringen dagegen Mehrwerte, auch für die politischen Debatten.
Die Digitalstrategie nennt (bis auf wenige Ausnahmen) keinerlei Zeitvorgaben. Wir lesen also verschiedene Maßnahmen in den verschiedenen Fachbereichen ohne dabei zu erfahren, wann wir eine bestimmte digitale Leistung erwarten und nutzen dürfen. Dann kann niemand in zehn Jahren sich beschweren, wenn immer noch zu wenig umgesetzt wurde.
Die Digitalstrategie nennt auch keinerlei Kosten. Den Finanzen wird zwar ein eigenes Kapitel gegönnt, doch lest selbst:
Um ihre positive Fortentwicklung im Sinne der digitalisierungsbezogenen Herausforderungen und Möglichkeiten zu gewährleisten, sind die aktuellen Haushaltsansätze im Rahmen der vorhandenen dezentralen und zentralen Mittel sowie nach Maßgabe der zukünftigen Haushaltsaufstellungsverfahren weiterzuentwickeln.
Die Prozesse für die Digitalisierung benötigen auch personelle Expertise. Bekanntlich fällt diese auch nicht vom Himmel. Daher gibt es beim „Amt für IT Digitalisierung“ einen „sog. Projektpool“. Vermutlich sind das diese kleinen schwarzen Löcher, die alle Probleme lösen?
Es ist kein Geheimnis, dass Hamburg in den vergangenen Jahren sich blaue Augen bei IT-Projekten geholt hat. Das wohl bekannteste ist KoPers. Hamburg führte eine neue Personalverwaltungssoftware Mitte 2018 ein – und über Monate hinweg wurden Gehälter entweder nicht oder nicht korrekt ausbezahlt. Und auch nach über einen Jahr funktioniert die Abrechnung bei Stellenwechsel immer noch nicht zuverlässig. Was passiert ist, lässt sich im Nachgang nicht ungeschehen machen. Aber wir dürfen sehr wohl erwarten, dass sich solche Szenarien nicht wiederholen. Doch in der Digitalstrategie lesen wir auch davon nichts. Lernen durch Schmerzen nur ohne Lernen?
Für die Piratenpartei ist Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre wichtig. Doch die Digitalstrategie sieht Datenschutz leider nicht als Chance und Stärke, sondern reduziert es eher auf eine Notwendigkeit. Wir sind beruhigt, dass Hamburg sich nicht über EU-Recht (DSGVO) hinwegsetzen möchte, dennoch gibt es bei vielen Digitalisierungsprojekten Spielräume. Im Bereich Gesundheit und Soziales sollen Schnittstellen zwischen PROSOZ (Sozialverwaltung) und JUS-IT (Jugendhilfe) mit der eAkte geschaffen werden. Leider ist dieser Aspekt zu schwammig beschrieben. Für uns als Piraten ist es ein NoGo, wenn an einer zentralen Stelle solche sensiblen Daten zusammengefasst werden. Und es gibt auch gute Gründe, warum bestimmte Daten stets getrennt bleiben sollen.
Die Stadt Hamburg verfügt derzeit über rund 800 verschiedene IT-Fachverfahren. In der Digitalstrategie hofft man, dass neue Softwarestandards und Innovationen Potenziale für eine bessere Effizienz sowie Prozessoptiomierung bergen. Wird ein schlechter Prozess digitalisiert, so bleibt er eins: ein schlechter Prozess. Wir sollten Digitalisierung auch als Chance verstehen, Dinge neu zu durchdenken. Beim Thema Führerschein-Erneuerung sind diese Überlegungen richtig: da der Austausch nur formaler Natur ist, könnte die Neubeantragung über ein Online-Formular wesentlich einfacher von statten gehen. Doch leider gibt es nur wenige solcher Bereiche. Ein denkbares Beispiel: Mit der Geburt eines Kindes beginnt heute auch ein bürokratischer Akt: die Geburtsurkunde muss mehrfach ausgestellt werden, das Kind bekommt eine Steuernummer, für das Kind gibt es einen Kindergeldanspruch und in gewisser Hinsicht besteht auch künftig ein Anspruch auf einen Kita-Platz. Warum nicht all diese Dinge so gestalten, dass beim Verlassen des Kreißsaals schon alles geklärt ist?
Die Digitalstrategie betrifft auch die Schulen und die Unterrichtsgestaltung:
Außerdem werden in den Grundschulen mobile Endgeräte im Verhältnis Endgerät zu Schüler von 1:4 und in weiterführenden Schulen im Verhältnis von 1:5 angeschafft, die in allen Schulen eigene mobile Endgeräte der Schülerinnen und Schülern im „Bring Your Own Device“ (BYOD) im Unterricht ergänzen
Den Ansatz der Schülereigenen Geräte bietet zwar den Vorteil der Wahlfreiheit der Geräte und Plattformen, erfordert aber Pflege- und Wartungsaufwand seitens der Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern. Und wenn diese dies nicht leisten können, verlagert es die Probleme in die Schule. Nur die Lehrenden haben nicht die Aufgabe und die Pflicht, Administrator zu spielen. Und auf diese Punkte geht dann das Konzept wiederum nicht ein.
Im Kapitel „Mobilität & Energie“ der Digitalstrategie spiegeln sich auch die Präferenzen der derzeitigen Hamburger Verkehrspolitik wieder. Mittels Wärmekameras sollen Verkehrsdaten in Echtzeit erhoben werden. An 420 Orten. Davon 30 für den Radverkehr und keine für den öffentlichen Nahverkehr.
Erfolg hat bekanntlich viele Gesichter. Mit dem unter wesentlicher Mitwirkung der Hamburger Piraten über eine Volksinitiative entstandenen Transparenzgesetz hat sich die Freie und Hansestadt Hamburg auf dem Gebiet der Informationsfreiheit an die Spitze der Bundesländer gesetzt. Dies wird auch in der Digitalstrategie gefeiert:
Mit dem Transparenzgesetz und seiner Umsetzung in Form des Transparenzportals trägt Hamburg kontinuierlich dazu bei, dass das Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern und Staat von Vertrauen und einer gelebten Veröffentlichungskultur geprägt ist.
Schön wäre es, nur leider sieht die Praxis anders aus. Die pauschalen Ausnahmen von der Informationspflicht für Informationen, die unter spezialgesetzliche Vertraulichkeitsvorschriften oder die Verschlusssachenanweisung für die Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg fallen, gehören gelockert. Um ein Dokument zur Verschlusssache zu erklären existieren derzeit keine ernsthaften Hürden, so dass auf diese Art und Weise den Bürgern Informationen vorenthalten werden dürfen, die nach dem Wortlaut des Transparenzgesetzes eigentlich nicht schützenswert wären. Dieses Unterlaufen der Absicht des Gesetzgebers muss gestoppt werden. Ebenso ist die absolute Bereichsausnahme für das Landesamt für Verfassungsschutz aufzuheben.
Zusammenfassend gibt diese Strategie einen Überblick über Projekte, mit denen sich die Stadt Hamburg gerade beschäftigt. Eine Strategie ist es dagegen nicht. Wir wissen nicht, wo wir in fünf Jahren stehen werden. Das wollen wir gerne konkreter machen. Des weiteren wollen wir freie WLAN-Netze voranbringen (z.B. nicht nur an den U-Bahnhöfen, sondern auch in den Verkehrsmitteln) und die Mittel und Möglichkeiten des Landesdatenschutzbeauftragten stärken. Daher stehen wir am 23.02. zur Wahl!